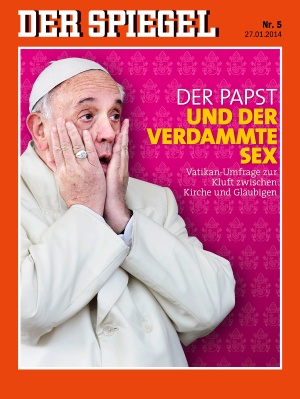Dieser Post schließt an meinen vorletzten zur kirchlichen Sexualmoral an.
 |
| (c) pfarrbriefservice.de - Johannes Simon |
In der öffentlichen Diskussion innerhalb der kath. Kirche scheint es in den letzten Monaten kaum wichtigeres Thema zu geben als die Situation derer, die in 2., 3., 4. Ehe leben, also nach einer Scheidung eine neue Beziehung eingehen, vielleicht sogar wieder heiraten. Für die katholische Kirche ist das (anders als für unsere evangelischen Schwestern und Brüder) ein Problem, denn sie geht davon aus, dass eine sakramental geschlossene Ehe nicht wieder gelöst werden kann. Wer daher eine neue Beziehung eingeht – begeht damit seinem ersten Ehepartner gegenüber – Ehebruch.
Für viele Menschen klingt das heute weltfremd. Welche Verpflichtungen kann man noch gegen einen Partner haben – der längst keiner mehr ist – und von dem man staatlich geschieden ist und mit dem man – hoffentlich – alles, vieles geklärt hat.
Geradezu archaisch mutet es für viele an, wie die Kirche dann über die Ehe, das Eheband spricht, das auch über Trennung und Scheidung hinaus das Paar “bindet”. Und diese Bindung entsteht - das Kirchenrecht definiert es genau – durch den “Vollzug der Ehe”, sprich den Geschlechtsverkehr, der die Voraussetzung für die “Gültigkeit” einer Ehe ist. Das klingt in den Ohren eines modernen jungen Paares sicher ziemlich komisch.
In den letzten Wochen war zu lesen, dass einige bedeutende Kardinäle der Kirche über die “Unauflöslichkeit” einer “vollzogenen Ehe” mehr oder weniger offen und über die Presse "streiten". Kardinal Müller sagt so, Kardinal Marx etwas anders, Kardinal Kasper stellt (nicht zum ersten Mal) sehr berechtigte Anfragen an die kirchliche Praxis. Kardinal Caffarra widerspricht Kasper energisch! Es steht zu erwarten, dass die innerkirchlichen Auseinandersetzungen ihren Höhepunkt noch lange nicht erreicht haben.
Wie wird das wohl auf unsere Mitmenschen wirken, als weiterer Beleg dafür, dass die Kirche “weltfremd und abgehoben” ist - oder als Signal, dass die Kirche die Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art in sich aufnimmt und für sie und mit ihnen nach Lösungen sucht. Entscheidend wäre, dass man der Botschaft Jesu über die Ehe und seinen Worten zu 100 Prozent gerecht werden muss. Entscheidend ist auch, dass die sakramentale Ehe keinen Schaden nimmt und dass nicht der Eindruck entsteht, die Kirche gibt das Ideal auf, dass ein Mann und eine Frau das Leben miteinander teilen möchten, durch dick und dünn bis zum Tod.
Dass es so schwierig ist für die katholische Kirche, hier zu einer “einfachen Lösung” zu kommen, liegt in der Sakramentalität der Ehe und der hohen zeichenhaften Bedeutung dieses Sakramentes, wie Papst Franziskus vor einigen Tagen noch in einer Katechese deutlich machte: “Die Ehe gründet auf einem zweifachen göttlichen Geheimnis. Zum einen betrifft das die göttliche Trinität: Der dreifaltige Gott, der wesenhaft eins ist, macht die Ehepartner zu einer einzigen Existenz, zu »einem Fleisch«, als Bild seiner eigenen Liebe und als Zeichen für eine Gemeinschaft, die in Gott ihren Ursprung hat und aus ihm ihre Kraft bezieht. Zum anderen zeigt sich dieses Geheimnis unter einem christologischen Aspekt: Die christlichen Ehegatten spiegeln die gleichsam bräutliche Beziehung Christi zur Kirche wider.”
Letztendlich ist die Tiefenströmung hinter der manchmal etwas oberflächlichen Diskussion, die, ob die Aufgabe dieses strahlenden Bildes der Ehe als Abbild der göttlichen bzw. jesuanischen Liebe nicht letztlich das eigentliche Dogma der göttlichen Dreifaltigkeit oder der großen Liebe Christi zu den Menschen in Frage stellt. Leider habe ich auch keine Idee, wie der “gordische Knoten” zu durchtrennen ist.
Bei vielen Diskussionen über “barmherzige Lösungen” geht es direkt um “das große Ganze”, die (oft verbissenen) Verteidiger der traditionellen Auffassung der lateinischen Kirche von der Unauflöslichkeit der Ehe kämpfen gegen jede Veränderung und verweisen auf die klassischen Möglichkeiten der “Josefsehe” oder der kirchenrechtlichen Überprüfung, ob überhaupt eine sakramentale Ehe zustande gekommen ist.
Doch wie überzeugend ist eigentlich das z.B. von Prof. Jos. Spindelbök wieder in die Diskussion eingebrachte Konzept einer “Josefsehe”, also einer Enthaltsamkeit in der zweiten Ehe? Was macht den Aspekt der “leiblichen Begegnung” für die Kirche so bedeutsam, dass sie solche “Lösungen” vorschlägt? Ist das (verliebte) Zusammenleben von zwei Menschen in einer neuen Beziehung (in den Augen der Öffentlichkeit, in den Augen des ehemaligen Partners, in den Augen Gottes anderswertig - sobald Sex dazu kommt? Und wo fängt Sex an, dürfen beide zusammen in einem (Ehe-)Bett schlafen, geht eine Umarmung, geht es, einander “nackt zu sehen”. Es hat etwas durchaus Absurdes... “Enthaltsamkeit” ... ich denke es gäbe viele Paare, die auf Geschlechtsverkehr – zumal im Alter – durchaus verzichten könnten oder die lieber “kuscheln” würden. “sie sich verpflichten, völlig enthaltsam zu leben, das heißt, sich der Akte zu enthalten, welche Eheleuten vorbehalten sind‘“ (Zitat: Familiaris Consortio). Und wenn in der zweiten Ehe dann aus der Liebe zwischen Mann und Frau Leben weiter gegeben wird und die gemeinsamen Kinder die beiden Eheleute zusammen binden. Wenn die Fruchtbarkeit einer sakramentalen Ehe ein bedeutsamer Bestandteil dieser Sakramentalität darstellt – dann kann es doch auch nicht bedeutungslos sein, wenn “Kinder das Band der Liebe zwischen den Eltern verstärken und bereichern.” (Kardinal Kasper in der Rede vor den Kardinälen).
Die Auseinandersetzung um die Bedeutung der Ehe hat in der Kirche ja schon eine lange Geschichte, denken Sie nur an die Abspaltung der Anglikanischen Kirche, die ja durch ein ebensolches Problem ihren Anfang nahm. Aber, aus der Geschichte kann man auch lernen, dass die Kirche auch jenseits der Worte Jesu gute Gründe hat alles zu tun, damit das Versprechen der Eheleute, miteinander durch gute und böse Zeiten zu gehen bis dass der Tod sie scheidet, ausgesprochen, versprochen, gelebt und durchlitten werden kann.
Ich denke, es ist nicht falsch zu behaupten, dass die Ehe das einzige Sakrament ist, dass sich in der Beständigkeit bewähren soll; wo die Sakramentalität selbst im Zusammenbleiben - bis dass der Tod die Partner scheidet - begründet liegt. In allen anderen Sakramenten, vielleicht mit Ausnahme der Weihe, geht es stärker um einen besonderen Moment der Gottesbegegnung, in der Teilhabe am eucharistischen Mahl, in der Vergebung meiner Sünden, in der Stärkung durch die Krankensalbung, in der Aufnahme eines Menschen in die christliche Gemeinschaft in der Taufe und der Besiegelung mit dem Hl. Geist. Die Ehe soll in ihrer ganzen Dauer sichtbar und spürbar machen, dass Christus sich mit seiner Kirche inniglich verbunden hat, die Ehe (und die Familie) stellen daher die kleinste Zelle der Kirche, eine Hauskirche dar. “Indem Jesus in die Geschichte einer Familie eingetreten ist, hat er die Familie geheilt und geheiligt. Die Heilsordnung nimmt die Schöpfungsordnung auf. Sie ist nicht leib- und sexualitätsfeindlich; sie schließt Sexus, Eros und menschliche Freundschaft ein, reinigt und vollendet sie.” (Kardinal Kasper vor den Kardinälen)
Aber, sehen das wohl die vielen Paare so, für die der besondere Moment des Eheversprechens vor einem Priester in der Kirche vermutlich die eigentliche “Sakramentenspendung” ausmacht? Hier gäbe es auch für die Ehevorbereitung noch ein weites Feld, deutlich zu machen, wie ernsthaft es die Kirche mit diesem Sakrament – auch religiös – meint. Doch was bieten wir denen an, die nach einer guten Ehevorbereitung sagen: “Das ist mir eine Nummer zu groß!” Schicken wir sie in eine katholische “Ehe ohne Trauschein”, wo sie – wenn wir streng sind – ebensowenig zu den Sakramenten zugelassen wären wie ein Paar, bei dem ein Partner schon verheiratet war?
Was sagen wir Paaren, die im Grunde keine sakramentale Ehe schließen können bzw. wollen, weil sie z.B. kinderlos bleiben wollen, weil ein Partner das katholische Eheverständnis nicht teilt, die unbedingte Treue ausschließt u.s.w.. Wollen wir solchen Paaren ernsthaft anraten sich zu trennen? Oder müssen wir stärker lernen, die Gebrochenheit, die in den neuen Freiheiten und neuen Formen des Zusammenlebens liegt, positiver aufzunehmen und auf das Gute zu schauen, statt nur die “Defizite” zu kritisieren.
Bei keinem anderen Sakrament verbindet sich mit der Sakramentenspendung ein so ausgeklügeltes (kirchen-)rechtliches Regelwerk wie bei der Ehe. Und in der Diskussion über den Umgang mit “wiederverheirateten” Menschen geht es auch sprachlich oft mehr um “Recht” als um menschliche Schicksale. So wirkt schon die Formulierung (und der rechtliche Konstrukt) eines “bestehenen Ehebandes” abstrakt, formelhaft, theoretisch. Nicht einmal das Weihesakrament wird derartig “unantastbar” gehandhabt, ein Priester kann vom Papst laisiert werden, das ewige Gelübde einer Ordensfrau kann mit päpstlicher Erlaubnis aufgehoben werden, wenn sich zeigt, dass das Ordensleben dann doch ein Irrweg war. Nur bei der Eheschließung wird betont, dass selbst der Papst nicht die Vollmacht habe, ein “bestehendes Eheband” zu lösen.
Manchmal zeitigt diese Rechtsordnung heute auch Situationen, die zwar rechtlich sauber zu sein scheinen, aber doch eher Verwirrung als Klarheit stiften. Es kann die absurden Situation entstehen, dass ich eine Frau problemlos kirchlich – und sakramental gültig - heirate, die vorher dreimal und über Jahrzehnte jeweils mit katholischen Partnern standesamtlich verheiratet war und aus diesen Ehen mehrere Kinder hat, während eine Prüfung der Gültigkeit einer Ehe notwendig wäre, wenn ich eine evangelische Frau heiraten wollte, die zuvor evangelisch mit einem ebenfalls evangelischen Partner verheiratet war und deren Ehe nach einigen Monaten kinderlos in die Brüche ging, weil der Partner sie betrog.
Wenn wir weiterhin die Ehe als “Norm” oder “Idealfall” des Zusammenlebens von Mann und Frau gegen neue Lebensformen verteidigen möchten, und das auch über den Raum der Kirche hinaus in eine säkulare Gesellschaft hinein, dann stellt sich die Frage, ob mit dieser Ehe (als Zusammenleben eines Mannes und einer Frau – mit den aus dieser Beziehung hervorgehenden Kindern) zwingend das sakramentale Verständnis der kath. Kirche einhergehen muss. Müßte es nicht auch sowas geben, wie “Ehe light”, für all die Paare, die die hohen Anforderungen der kath. Kirche an eine sakramentale Ehe nicht einhalten können? Oder können wir ernsthaft wollen, dass die “Hochform” der sakramentalen Ehe nur noch Minderheiten erreicht, während wir fast alle anderen Formen des Zusammenlebens von Menschen einen Stempel “defizitär” aufdrücken. Ich weiß, dass dieser Gedanke natürlich neue Probleme aufwirft.
Es wird uns nicht mehr gelingen, den bunten “Beziehungskisten” der Menschen eine einheitliche (kanonische) Form zu geben. Kaum jemand liebt seinen Partner mit schlechtem Gewissen. Und wenn doch – wäre das sehr fragwürdig. Wer sich in eine “verlassene Ehefrau” verliebt, wird – wenn er sich später langsam der Kirche annähert – wohl kaum inneres Verständnis für den Ausschluß von den Sakramenten entwickeln - weil er doch selbst keinen Fehler begangen hat. Aber wie können wir mit Blick auf die Ehe hieraus eine frohe und missionarische Verkündigung erwachsen, wenn wir erst einmal neue Schwellen und Hürden errichten?
Was soll ich als Katholik schlecht an einer Beziehungsgeschichte in meinem Freundeskreis finden, wo eine – eher säkulare – Muslimin mit einem – ebensowenig praktizierenden – katholischen Mann zusammen lebt? Die beiden haben inzwischen das zweite gemeinsame Kind, leben seit einiger Zeit im gemeinsam gekauften Haus und haben sich jetzt gerade “verlobt”. Und wollen bald heiraten? Muss ich Ihnen jetzt “missionarisch” klar machen, dass es alles verkehrt war was sie getan haben? Jeden Schritt in ihrer Beziehung sind sie voller gegenseitiger Liebe gegangen....
„Die Kirche bekräftigt jedoch ihre auf die Heilige Schrift gestützte Praxis, wiederverheiratete Geschiedene nicht zum eucharistischen Mahl zuzulassen. Sie können nicht zugelassen werden; denn ihr Lebensstand und ihre Lebensverhältnisse stehen in objektivem Widerspruch zu jenem Bund der Liebe zwischen Christus und der Kirche, den die Eucharistie sichtbar und gegenwärtig macht.” So heißt es im bedeutsamen päpstlichen Schreiben: Familiaris consortio von Papst Johannes Paul II.
Der Eindruck der Menschen von heute ist, dass kaum eine Sünde oder ein Vergehen “kirchenamtlich” so hart bestraft wird wie die neue Liebe und die neue Ehe nach einer gescheiterten ersten Ehe. Wem wäre es – auf die Spitze getrieben – zu vermitteln, dass zwar die Frau zur Kommunion gehen kann, die ihren Mann ermordet hat, während ihres Gefängnisaufenthaltes gebeichtet hat und dann einen katholischen Mitgefangenen geheiratet hat – nicht aber die Frau, die von ihrem Mann – zugunsten einer jüngeren Frau – mit den Kindern sitzen gelassen wurde und die dann nach einigen Jahren den alleinstehenden Nachbarn geheiratet hat, der sich mit Rat und Tat für sie und ihre Kinder nach der Trennung eingesetzt hat? Oder denken Sie an die junge Frau, die einen ebenso jungen Mann kennenlernt, sich in ihn verliebt und dann erfährt, dass er vor vier Jahren schon einmal – quasi als Jugendsünde – eine andere Frau geheiratet hatte, eine Beziehung, die schon nach einem halben Jahr in die Brüche ging.
Wie können wir missionarisch tätig sein in einer Gesellschaft, wo nicht wenige aus dem “zu missionierenden “Publikum”” in zweiter oder dritter Ehe (oder einer Patchworkfamilie) leben? Das sind doch Fragen, die nur schwer zu ignorieren sind, auch von denen nicht, die “bis aufs Messer” die Unauflöslichkeit der Ehe gegen jede Ausnahme verteidigen.
“Ließe man solche Menschen zur Eucharistie zu, bewirkte dies bei den Gläubigen hinsichtlich der Lehre der Kirche über die Unauflöslichkeit der Ehe Irrtum und Verwirrung.” Wenn dieses Argument wirklich “stichhaltig” wäre, dann ist es doch zur Zeit so, dass die Haltung der Kirche “Irrtum und Verwirrung” erzeugt über die barmherzige Liebe Gottes zu den Menschen. Es kehren Menschen der Kirche den Rücken, weil sie diese Haltung als “unbarmherzig” erfahren. Auch hier sollte eine Katechese möglich sein, die Einzelfälle möglich macht und die grundsätzliche Wertschätzung der Kirche für die Ehe erfahrbar werden läßt. Im Zweifel kann auch bei einer in der Gemeinde bekannten und mit durchlittenen Trennungsgeschichte im Hintergrund eine sakramental ungültige Ehe stehen. Niemand kann das als Außenstehender durchschauen und es kann auch nicht wünschenswert sein von “kirchenamtlicher” Seite jeweils öffentliche Erklärungen zum Stand der Gnade einzelner Eheleute und Paare abzugeben.
Kardinal Kasper vertritt demgegenüber, als Frage formuliert: „Aber wenn ein geschiedener Wiederverheirateter bereut, dass er in der ersten Ehe versagt hat, wenn die Verbindlichkeiten aus der ersten Ehe geklärt sind und ein Zurück definitiv ausgeschlossen ist, wenn er die in der zweiten zivilen Ehe eingegangenen Verbindlichkeiten nicht ohne neue Schuld lösen kann, wenn er sich aber nach besten Kräften darum müht, die zweite zivile Ehe aus dem Glauben zu leben und seine Kinder im Glauben zu erziehen, wenn er Verlangen nach den Sakramenten als Quelle der Kraft in seiner Situation hat – müssen oder können wir ihm dann nach einer Zeit der Neuorientierung das Sakrament der Buße und die Kommunion verweigern?“ (S. 66)
Es geht ihm also nicht um eine allgemeine Lösung, sondern um das einzelne Schicksal. Überhaupt muss man darauf achten, hier keinen kirchenpolitischen Kampfplatz zu kultivieren. Wenn wir von “wiederverheirateten Geschiedenen” sprechen, dann geht es um völlig unterschiedliche Lebens- und Leidensgeschichten. Es sollte klar werden, dass es hier nicht um eine generelle Zulassung zu den Sakramenten geht, sondern um einzelne Fälle.
Wie könnten nun konkrete Lösungen aussehen?
Ein erster Schritt sollte sein, in der ganzen Kirche umzusetzen, was schon Papst Johannes Paul II. in “Familiaris Consortio” fordert: “Die Hirten mögen beherzigen, daß sie um der Liebe willen zur Wahrheit verpflichtet sind, die verschiedenen Situationen gut zu unterscheiden. Es ist ein Unterschied, ob jemand trotz aufrichtigen Bemühens, die frühere Ehe zu retten, völlig zu Unrecht verlassen wurde oder ob jemand eine kirchlich gültige Ehe durch eigene schwere Schuld zerstört hat. Wieder andere sind eine neue Verbindung eingegangen im Hinblick auf die Erziehung der Kinder und haben manchmal die subjektive Gewissensüberzeugung, daß die frühere, unheilbar zerstörte Ehe niemals gültig war.” Es kommt also darauf an, genau hinzusehen und mit den Betroffenen Wege zu gehen und ihnen Wege in die Gemeinde zu eröffnen. Hier sind noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Das kirchliche Arbeitsrecht wäre vor diesem Horizont ebenfalls zu reformieren. Und manchmal wird mit den Betroffenen leider auch im normalen Gemeindeleben recht hartherzig umgegangen.
Ein anderes Konzept, das immer wieder vorgeschlagen wird, hängt mit der Formulierung des Eheversprechens zusammen, “bis dass der Tod uns scheidet”. Hieraus leiten manche Theologen die Idee des “geistigen Todes einer Ehe” ab. Aber eine solche Lösung klingt etwas “konstruiert”, ähnlich wie die fromme Idee der “vielen kleinen” Tode, die man im Laufe seines Lebens zu überstehen habe. Hier wäre es notwendig, einigermaßen nachvollziehbare Kriterien zu entwickeln, wann eine Ehe denn nun den “geistigen Tod” gestorben ist. Daraus kann schnell “überall und nirgends” werden und ein unverbindliches Geschwafel darüber, wann denn nun die Ehe gestorben ist (“als er mir die Affaire mit seiner Sekretärin beichtete, da spürte ich: unsere Ehe war soeben gestorben...”). Natürlich kann ich mir Situationen vorstellen, wo das “gültige Eheband” zwischen zwei Eheleuten endgültig und un”flickbar” gerissen ist. Ob aber ein eher sprachlicherer Lösungsvorschlag hier den richtigen Weg zu einer Lösung der Schwierigkeiten darstellt? Mich überzeugt das nicht.
Vermutlich macht es durchaus Sinn – auf dem Weg zu einer Lösung der Problemstellungen – noch einmal auf das Wort der Bibel und die Worte Jesu (und die des Paulus) zu hören. Es ist sicher nicht falsch zu behaupten, dass Jesus keine in sich abgeschlossene Ehetheologie dargelegt hat. Die Ehe war für ihn eher ein Randthema. Er kam darauf angesichts sehr konkreter Situationen zu sprechen, z.B. Im Kontakt mit der Ehebrecherin und im Gespräch mit den Pharisäern, wo es immer darum ging, ihn in einen theologische Klemme oder eine Falle zu locken. Auch sollte man berücksichtigen, dass gerade auch Paulus in seinen Aussagen von der Naherwartung Christi geprägt war. Von daher stellten sich Ehefragen vor diesem kurzen Horizont eher nur am Rande. Daher ja auch die Idee, es sei besser ehelos zu bleiben für die, die das können.
Ein weiterer Blick wäre sicher auch hilfreich auf die Entwicklung der Institution Ehe von der Zeit Jesu bis heute. Vermutlich hat es in keinem Zeitabschnitt der Geschichte so rasante Veränderungen gegeben, wie in den letzten Jahrzehnten in den westlichen – christlichen – Gesellschaften. Das Konzept einer “Liebesheirat” ist ja auch erst seit gut 100 Jahren in unserer Kultur verankert, wer in der Kirche würde heute etwas dagegen sagen? Auch haben manche Diskutanten darauf hingewiesen, dass das “bis der Tod uns scheidet” in der Vergangenheit oft schneller kam als gehofft, dass es den wenigsten Paaren über Jahrhunderte vergönnt war eine “silberne Hochzeit” zu feiern und das nicht, weil man sich trennte (das ging aus wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gründen nicht), sondern weil – allzu oft die Frauen im Kindbett – und allzu häufig die Männer auf dem Schlachtfeld oder an Krankheiten allzu früh starben. Dieser Blick in die gesellschaftlichen Entwicklungen sollte uns die veränderte Situation klar machen, in die wir unsere frohe Botschaft hineinsprechen und nicht der Relativierung der Verkündigung oder des Wortes Jesu dienen.
Auch wenn wir eine verantwortete Lösung für die Problematik der Geschiedenen finden – sie wird sicher von einer modernen Gesellschaft als rückständig und wenig angemessen gebrandmarkt werden, weil die Kirche mit Verweis auf göttliches Recht auf Einschränkungen der persönlichen Freiheit pocht. Wir können den gesellschaftlichen Entwicklungen nicht antizipierend hinterherlaufen und die Entwicklungen theologisch rechtfertigbar machen, wir müssen schon eine klare Position haben und bewahren, die eine Orientierung für gelingendes Leben möglich macht. Mit denen, die uns hier nicht folgen mögen oder können müssen wir aber auch vor diesem Hintergrund weiterhin offen, tolerant und “wertschätzend” umgehen.
Entscheidend für eine Lösung wird auch sein, wie wir die Eucharistie und den Empfang der Hl. Kommunion betrachten. Um eine Formulierung des Papstes Franziskus aufzugreifen; die Sakramentenspendung ist “nicht eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen.” Wobei das voraussetzt, dass man sich seiner “Schwäche” bewusst geworden ist. Wer sich selbst von aller Schuld frei spricht ... wird wohl kaum im Sinne Jesu die Eucharistie empfangen können. Vielleicht gehen wir heute viel zu selbstverständlich zu Hl. Kommunion, ohne wirklich aufrichtig in unser Herz zu schauen und unser Leben in Ordnung zu bringen (soweit es in unserer Macht steht). Auch in diese Richtung sollten wir denken.
Von manchen Diskussionsteilnehmern, wie z.B. von Carlo Kardinal Caffarra aus Bologna wird angemerkt, dass es zahlreiche geschiedene Männer und Frauen gäbe, die den spirituellen Weg der Kirche mitgingen und entweder keine neue Beziehung eingehen oder auf den Kommunionempfang verzichten insofern sie in zweiter Ehe leben. Kardinal Caffarra: “Ich bin wirklich sehr enttäuscht, ... wenn ich in diesen Wochen der Diskussion das Schweigen über die Größe von Ehefrauen und Ehemännern zur Kenntnis nehmen muss, die verlassen worden sind und treu bleiben.” (Was etwas in die Irre führt, denn das stimmt nicht. Auch Kardinal Kasper ist natürlich darauf eingegangen.) Wenn nun eine Reform in der Kirche möglich würde, dann würde dieser heroische Verzicht quasi nachträglich entwertet. Diese Argumentation lässt schon aufmerken, aber kann man wirklich den spirituellen Weg des einen Christen gegen den des anderen aufwiegen? Ich muss an meine Oma denken, für die eine zweite Hochzeit nach dem Kriegstod meines Opas niemals in Frage kam ... aber auch an deren Freundinnen, die teilweise wieder geheiratet haben. Ist der Dienst des verheirateten Diakons weniger wert als der des ehelosen Priesters? Auch wenn es andre legitime Möglichkeiten gibt, mit dem Ende einer Partnerschaft und Ehe umzugehen ... ist es doch dem Einzelnen vorbehalten unter Gottes Weggeleit “seinen” Weg zu suchen und zu finden. “Wer es fassen kann....”
Kurienerzbischof Lorenzo Baldisseri, der Sekretär der Bischofssynode erklärte, dass man bei der Synode “ohne Tabus” sprechen werde und schloss einen interessanten Satz an: “Die orthodoxe Erfahrung kann uns eine Hilfe sein“. Die orthodoxe Kirche ermöglicht eine weitere Heirat, verknüpft diese aber stark mit dem Aspekt der Buße. Und: diese zweite Ehe ist keine sakramentale Ehe mehr. Auch wenn im Westen die eigentlichen Hintergründe dieses orthodoxen Weges eher holzschnittartig und in Schlagworten zur Kenntnis genommen werden, wir dürfen gespannt sein, ob die Bischofssynode in diese Richtung denken wird und anerkennt, dass vielleicht in der Kirche des Ostens das Wehen des Hl. Geistes früher zu einer Lösung geführt hat, die Jesu Klarheit und Wahrheit mit seiner barmherzigen Haltung zusammen bringen konnte. Auf jeden Fall würde sich hier ein weites Feld der Seelsorge eröffnen, bei der auch manche Wunde heilen kann, die nach einer gescheiterten Ehe in den Herzen der beiden Eheleute geblieben sind. Am Ende eines solchen gemeinsamen Weges stände eine Zulassung zu den Sakramenten der Beichte und Kommunion, allerdings ohne eine weitere sakramentale Eheschließung. Auf diesem Weg können auch die Möglichkeiten des Kirchenrechts (Ehenichtigkeitsverfahren) oder auch das Konzept einer Josefsehe mit dem Paar besprochen und evtl. gegangen werden, weil in diesem Kontext für viele Paare eine “passende” Lösung gesucht und gefunden werden kann.
Der Vorschlag eine evtl. Zulassung zur Kommunion mit der Zustimmung des ehemaligen Partners zu verknüpfen halte ich für problematisch. Das wird ähnliche Folgen haben wie im orthodoxen Judentum, wo die Ehemänner ihrer Frau den Scheidungsbrief verweigern können und dies ab und an als Druckmittel missbrauchen.
In manchen Fällen wird sich nicht mit Sicherheit belegen lassen, dass eine Ehe als ungültig geschlossen zu betrachten ist. Eine Ehe wird aber an den Ehegerichten nur dann für ungültig erklärt, wenn die Beweislage eindeutig ist. Aber wie geht man mit solchen Fällen um, wo die Wahrscheinlichkeit einer Ungültigkeit hoch ist, die Beweisführung aber nicht gelingt? Müssen dann die betreffenden Partner um einer “sauberen Lehre willen” auf die Gnadenmittel der Kirche verzichten oder könnte es nicht hier leichter pastoral verantwortliche Lösungen geben? Hierauf zielt auch Kardinal Kasper in seiner Rede vor dem Konsistorium ab und geht sogar noch etwas weiter: “Faktisch sind viele Seelsorger davon überzeugt, dass viele religiös geschlossenen Ehen nicht in gültiger Form abgeschlossen werden. In der Tat, als Glaubenssakrament setzt die Ehe den Glauben voraus und die Akzeptanz der charakteristischen Besonderheiten der Ehe oder besser gesagt: der Einheit und Unauflöslichkeit. Können wir in der heutigen Situation davon ausgehen, dass die Brautleute den festen Glauben an das Sakrament teilen und dass sie die kanonischen Bedingungen für die Gültigkeit ihrer Ehe wirklich verstehen und akzeptieren?”
Diese Wege werden nicht leicht sein, ist die die Situation der Kirche und der Eheleute und Familien in der ganzen Welt im Blick zu halten. Und da sieht es oft anders aus als im modernen Westen. Und die lehramtlichen Linien sind deutlich gezogen, so hatte Papst Johannes Paul II. in Familiaris Consortio und ausdrücklich auch Kardinal Ratzinger in einem Text (Die Ehepastoral muss auf der Wahrheit gründen, veröffentlicht zuletzt 2011 im Osservatore Romano) zur Erklärung der Glaubenskongregation über den Kommunionempfang von wiederverheirateten Geschiedenen von 1994 den Weg der orthodoxen Kirche als ungeeignet abgelehnt. Ähnlich argumentiert gerade wieder dessen Nach-Nachfolger Gerhard Ludwig Kardinal Müller. Interessant ist an diesem Text des späteren Papstes, dass dieser für eine ganz klare, saubere Linie eintritt. Die Kirche könne “ihre Lehre und Praxis nicht auf unsichere exegetische Hypothesen aufbauen” und habe sich an die eindeutige Lehre Christi halten.
Bei einzelnen Kirchenvätern konstatiert der Kardinal allerdings, dass diese für “seltene Grenzfälle pastorale Lösungen suchten”. In der Reichskirche nach Konstantin hätte man dann zu einer größeren Flexibilität und Kompromißbereitschaft in schwierigen Ehesituationen gefunden. In der Ostkirche setzte sich diese Entwicklung nach Auffassung von Kardinal Ratzinger fort und “führte zu einer immer liberaleren Praxis”. “Im ökumenischen Dialog muß dieses Problem unbedingt zur Sprache gebracht werden.”
Interessant ist, dass Kardinal Ratzinger durchaus schon die Frage stellt, die auch Kardinal Kasper bewegte, wenn er schreibt: “Weiterer gründlicher Studien bedarf allerdings die Frage, ob ungläubige Christen ... wirklich eine sakramentale Ehe schließen können. Zum Wesen des Sakraments gehört der Glaube; es bleibt die rechtliche Frage zu klären, welche Eindeutigkeit von Unglaube dazu führt, dass ein Sakrament nicht zustande kommt.” Bedenkenswert!
Der nachmalige Papst Benedikt XVI. hält also wenig von dem skizzierten Auswegen und schließt seinen Text mit den Worten: “Sicherlich kann das Wort der Wahrheit weh tun und unbequem sein. Aber es ist der Weg zur Heilung, zum Frieden zur inneren Freiheit...” Hier bleibt allerdings zu fragen, ob eine Wahrheit, die ganz offensichtlich nicht immer zu Heilung, Frieden und innerer Freiheit führt, dann für jeden einzelnen Fall wahr sein kann.
Kardinal Kasper stellt noch eine weitere Frage, auf die die Synode eine überzeugende Antwort geben muss: “Wenn wir wiederverheiratete geschiedene Christen, die disponiert sind, von den Sakramenten ausschließen und sie auf den außersakramentalen Heilsweg verweisen, stellen wir dann nicht die sakramentale Grundstruktur der Kirche in Frage?” Vielleicht muss man in diesen schwierigen Problemen wirklich auch einmal anders und vielseitiger an die Fragen herangehen.
“Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!”